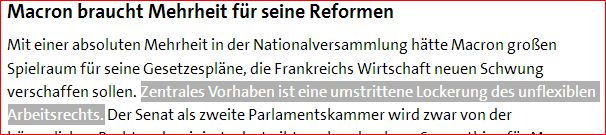1.) Der Redaktionsleiter des „heute journal“, Dr. Wulf Schmiese, hat mir nach meiner Kritik an der ZDF-Sendung vom 26.6. mit Bernd Raffelhüschen zum Thema „Rente“ geantwortet.
Meine Kritik habe manches für sich, zum Beispiel sei vorgesehen gewesen, auf Raffelhüschens Rolle als „Ergo“-Aufsichtsrat hinzuweisen. Bei einem etwaigen nächsten Male solle das besser laufen. Insofern – bleiben wir gemeinsam dran und sehen mit vielen Augen weiterhin und noch besser auch auf das „Zweite“.
2.) In der „Märkischen Allgemeinen“ in Potsdam las ich am 15.7. folgenden Beitrag in der Form eines Interviews mit dem Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs:
Hier geht es zur MAZ-Seite mit dem Text
Darüber hatte in der Printausgabe ein längerer informationsbetonter Beitrag zum Thema gestanden.
Ich schrieb daraufhin an die Redaktion:
„Ich lese Ihre Zeitung immer mal wieder in der Printversion und noch häufiger online – und ich wundere mich leider nicht selten über gewisse Tendenzen zur „Hofberichterstattung“ gerade bei kontroversen und wichtigen Themen in Potsdam.
Konkret die Seite 15 der Ausgabe vom Samstag, 15.7.:
Die große Überschrift lautet: Fachhochschule nicht zu retten
Das scheint kein Zitat zu sein, sondern offenbar die Meinung der Redaktion? Oder auch die der SPD-Politiker Jann Jakobs oder Klara Geywitz, die ja auf der Seite ausführlich in Wort und Bild zum Zuge kommen?
Man weiß es nicht – was ich aber weiß, ist, dass es Leute gibt, die das anders sehen.
Die Unterzeile lautet: Abrissbeschluss ist politisch und juristisch unumkehrbar
Auch das ist nicht als eine Version von wem auch immer zu erkennen – wiederum die Meinung der Redaktion?
Das ist auch deswegen spannend, weil Sie sich gewiss erinnern, dass gerade hier in Potsdam über das Stadtschloss zunächst 2006 zweimal im Stadtparlament abgestimmt wurde, jeweils GEGEN einen Wiederaufbau als Landtag. Diese beiden Abstimmungen wurden damals und werden heute in der herrschenden Diktion „gescheitert“ genannt, obwohl sie einfach nur ein bestimmtes Ergebnis hatten – KEIN Wiederaufbau. Wer das als „Scheitern“ bezeichnet(-e), macht seine Parteinahme deutlich. Erst im dritten Anlauf dann, 2007, gab es (da die Linke umschwenkte) das offenbar „richtige“ Ergebnis. Kritiker sagten damals und sagen heute, in einer bestimmten Auffassung von „Demokratie“ lasse man eben so lange abstimmen, bis das (von oben) gewünschte Ergebnis herauskomme.
Jetzt aber, mit Blick auf die Alte Fachhochschule, soll alles definitiv alternativlos sein? Kann man so sehen, muss man aber nicht …. Denn „die Demokratie“ in ihrer Reinform gibt es kaum, sondern am ehesten wohl mehr oder weniger demokratische Verfahren. Was das jeweils ist, darüber sollte in demokratisch verfassten Gesellschaften möglichst vielfältig und öffentlich debattiert werden, oder?
Mein ganz konkreter und deutlichster Kritikpunkt ist das „Interview“ von Ildiko Röd mit dem Oberbürgermeister Jann Jakobs, im afrikanischen Sansibar geführt. Es erscheint mir sehr einseitig und geradezu mitfühlend mit dem Stadtoberhaupt.
Frau Röd fragt den OB ohne Quellenangabe (als Quelle müsste die Polizei angegeben werden), dass ein Polizist verletzt worden sein soll. Sie fragt nicht (wofür es andere Quellen gibt), inwiefern Aktivisten verletzt worden sein sollen. Sie bewertet die Entwicklung als „Eskalation“, was ein klar negativ konnotiertes Wort ist. Und da den Sicherheitskräften (warum auch immer, Quellen?) „Deeskalation“ bescheinigt wird, ist klar, wer für die Zuspitzung verantwortlich ist laut Frau Röd. Sehr fragwürdig.
„Bis Sonntag ist ein Protestcamp angemeldet. Macht Ihnen das Sorgen?“ fragt Frau Röd, wiederum sehr wertend. Sie hätte auch relativ sachlich fragen können: „Wie sehen Sie das?“ oder auch „Wie bewerten Sie das?“. Am deutlichsten kommt die (wahrscheinlich sogar unbewusste) Parteinahme der MAZ-Reisenden aber zum Ausdruck in der Formulierung: „Befürchten Sie, dass sich ähnliche Vorfälle in Zukunft wiederholen könnten?“ Das ist eine unglaublich klare Bewertung, denn „befürchten“ bezieht sich immer auf deutlich Negatives. Konstruktiv anders formuliert (ich arbeite auch in der Branche): „Erwarten Sie, dass sich ….?“ oder auch „Gehen Sie davon aus, dass …?“
Dass Frau Röd dann auch noch die Vielfalt der Kritiker des OB-Kurses alle in einen Topf wirft mit der Formulierung „die Kritiker sagen ….“ – geschenkt im Lichte der anderen Fragwürdigkeiten.
Woran fehlt es dem Beitrag meines Erachtens? Ich denke, an einer grundsätzlichen, professionellen Distanz zu Person und Gegenstand des Interviews. Alternativen tauchen praktisch nicht auf (außer der, dass „im Vorfeld“ noch mehr für „die Sicherheit des Gebäudes“ hätte getan werden sollen). Frau Röd fragt leider so gar nicht kritisch nach.
Könnte das womöglich (mal auf die Strukturen geschaut) auch daran liegen, dass sie auf Kosten der Stadtverwaltung mit im Reisetross des OB unterwegs ist? Oder sollte die Unabhängigkeit der journalistischen Bericherstattung insofern gewährleistet sein, als die MAZ komplett die Reise von Ildiko Röd bezahlt?
Gerade weil ja der eine oder andere Pressesprecher der Stadt vor dem Job im Rathaus als Journalist tätig war, sollte meines Erachtens der Eindruck gar nicht erst aufkommen dürfen, dass Beiträge wie dieser auf mich eher als Beispiele von Auftragskommunikation wirken denn als Journalismus.
Oder mal ganz bewusst polemisch formuliert: Wer solche Journalisten im Schlepptau hat, der braucht keine Pressestelle (mehr). Und mit Blick auf die Vertrauenswürdigkeit journalistischer Medien: Da könnten wir doch gleich den Newsletter aus dem Rathaus abonnieren. Die werden ja mittlerweile von den Profis jener Branche auch schon in Dialogform angeboten, wegen der besseren Lesbarkeit ….
Was meinen Sie? In der Hoffnung auf eine konstruktiv-kritische Debatte verbleibe ich mit freundlichem und kollegialem Gruß….“
Darauf schrieb mir der stellvertretende Chefredakteur der MAZ, Henry Lohmar:
„(…) haben Sie vielen Dank für Ihr Schreiben, das von profunder Kenntnis sowohl der Potsdamer Verhältnisse als auch der Regeln professioneller journalistischer Berichterstattung zeugt. Sie haben einige wichtige Punkte angesprochen, auf die ich gerne eingehen will. Der wichtigste, darum gleich am Anfang: Unsere Redakteurin Ildiko Röd ist nicht auf Kosten der Stadtverwaltung nach Sansibar gefahren, sondern auf Kosten der MAZ. Sowohl der Flug als auch die Unterkunft werden vom Verlag bezahlt. Darauf haben wir im Vorfeld großen Wert gelegt, um eben nicht den Verdacht zu nähren, wir betrieben Hofberichterstattung. Ihren, wie Sie selbst sagen, polemisch formulierten Satz „Wer solche Journalisten im Schlepptau hat, der braucht keine Pressestelle mehr“ möchte ich feundlichst, aber bestimmt zurückweisen.
Nun zu Ihrer Kritik an unserer Berichterstattung: „Fachhochschule nicht zu retten“ – ist diese Überschrift nachrichtlich gedeckt? Streng genommen nein, da bin ich bei Ihnen, denn weder ist das ein Zitat eines Protagonisten aus dem Text, noch sind die Bagger bereits angerückt. Ein anderes Szenario ist also theoretisch auch noch denkbar. Aber wenn Sie den Text anschauen – Ihnen als Dozent und Kenner der Materie muss ich das eigentlich nicht sagen – , dann sehen Sie, dass es sich hierbei um ein erklärendes Hintergrundstück in Frage- und Antwort-Form handelt, keine Nachricht im engeren Sinne. Die Nachricht des Tages zur FH steht auf der Titelseite der Potsdamer Ausgabe, wie Sie sicherlich gesehen haben. Das Stück im Lokalteil dient der Ergänzung und Vertiefung. Die Überschrift bezieht sich ganz klar auf die geltende Beschlusslage, ist mithin eine Beschreibung des juristischen Status quo. Ob dieser „unumkehrbar“ ist – darüber kann man streiten. Daher, auch das räume ich ein, lehnen wir uns mit der Unterzeile sehr weit aus dem Fenster.
Ihr Einwand, es habe auch beim Stadtschloss mehrere Abstimmungen gegeben, ist richtig. Aber was heißt das für uns bei der Berichterstattung? Sollen wir den demokratisch zustande gekommenen Beschluss zum Abriss der FH negieren, nur weil zukünftig ja vielleicht noch mal anders entschieden werden könnte?
Das Interview mit dem OB: Ihre Anmerkungen kann ich nur zum Teil nachvollziehen. Hätte man kritischer nachfragen können? Sicher, auch wenn ich bis jetzt noch nicht mit Frau Röd über die Begleitumstände sprechen konnte (die wiederum für den Leser natürlich keine Bedeutung haben). Der Einstieg „Wie bewerten Sie die Ereignisse“ ist jedoch absolut neutral formuliert, ob der OB sich wegen des Protestcamps „Sorgen macht“, ist eine Frage, die durchaus nahe liegt, und deren bejahende Beantwortung sogar einen gewissen Nachrichtenwert gehabt hätte. „Eskalation“ bedeutet Zuspitzung, und das ist ja wohl angesichts der Ereignisse vom Donnerstag nicht übertrieben formuliert. Dass Frau Röd den OB mit einem zentralen Punkt der Kritiker konfrontiert, nämlich dem, das Projekt am Alten Markt werde „einfach durchgedrückt“, wischen Sie nonchalant weg.
Ich will Ihre Kritik damit nicht komplett zurückweisen, aber ich lese in ihr auch eine deutliche Sympathie mit dem Anliegen der Besetzer. Das ist völlig legitim. Was aber sehr schade wäre: Wenn sich bei Ihnen der Eindruck verfestigte, die MAZ würde im Streit um die Bebauung der historischen Mitte einseitig und noch dazu unter Missachtung journalistischer Standards berichten.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen anderen Beitrag aus der MAZ ans Herz legen, der ebenfalls am Samstag erschienen ist. Er schildert die Auseinandersetzung um die architektonische DDR-Moderne in Potsdam aus einer distanzierten Perspektive und ist in unseren Nicht-Potsdamer Ausgaben erschienen:
http://t.maz-online.de/Brandenburg/Wie-viel-DDR-Architektur-vertraegt-Potsdam
Ich verspreche Ihnen: Wir bleiben dran am Thema und werden sachlich und kritisch berichten, wie es unsere Aufgabe ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns als kritischer Leser erhalten blieben. Melden Sie sich gerne bei mir, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen los werden wollen. Ich freue mich.
Mit den besten Grüßen …“
Worauf ich wiederum an Henry Lohmar schrieb:
„(…) vielen Dank für Ihre rasche und ausführliche Reaktion auf meine Zeilen.
Ich freue mich, dass Sie einige meiner Kritikpunkte nachvollziehen können. Und natürlich sollten wir Journalisten geltende Beschlusslagen nicht schlicht „negieren“, aber eben auch nicht einfach „absolut“ setzen. Sondern, wie so oft im Leben, möglichst differenziert betrachten. Da dürften wir wieder dicht beiander liegen.
Die heutigen Zeilen zum Thema im Blatt kann ich übrigens gut nachvollziehen im Sinne von Objektivierung der Ereignisse. Und das in diesem Fall, wie Sie ebenfalls ganz richtig einschätzen, mit (und nicht trotz oder wegen) einer gewissen Sympathie für die Anliegen der Leute von „Stadtmitte für alle“.
Eine „MAZ“ für möglichst viele Potsdamerinnen und Potsdamer, Nutzerinnen und Nutzer ist doch ein sinnvolles Ziel ….“
Was lehrt das womöglich? Wenn Medien und Nutzer vergleichsweise sachlich und auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, lässt sich manches lernen und manches ändern.
3.) ZDF-Börsenexperte Frank Bethmann sprach jüngst wieder einmal davon, dass eine bestimmte Aktie einen „Dazu-Gewinn“ erzielt habe. Klar, das ist wichtig zu sagen und zu wissen, denn es gibt ja auch „Hinweg-Gewinne“ und sogar „Null-Gewinne“. Oder wären all das eher „Blasen“, die es ja in der Finanzwelt auch nicht zu knapp geben soll? „Doppelt gemoppelt“ muss nicht sein. Deshalb an dieser Stelle ein großes Lob an die „Berliner Zeitung“, Ressort Sport: Dort stand am 24.7.2017 auf Seite 19 im Beitrag von Maik Rosner über den FC Bayern etwas zu den „Zugängen Niklas Süle und Sebastian Rudy“ aus Hoffenheim. Spinnen die dort bei der BLZ? Fast alle anderen schreiben doch gefühlt seit Jahrhunderten von „Neuzugängen“, wenn Sportler zu einem anderen Verein wechseln.
Aber in der Tat: Hier einfach von „Zugängen“ zu schreiben, wäre ein Gewinn, pardon: „Dazu-Gewinn“.